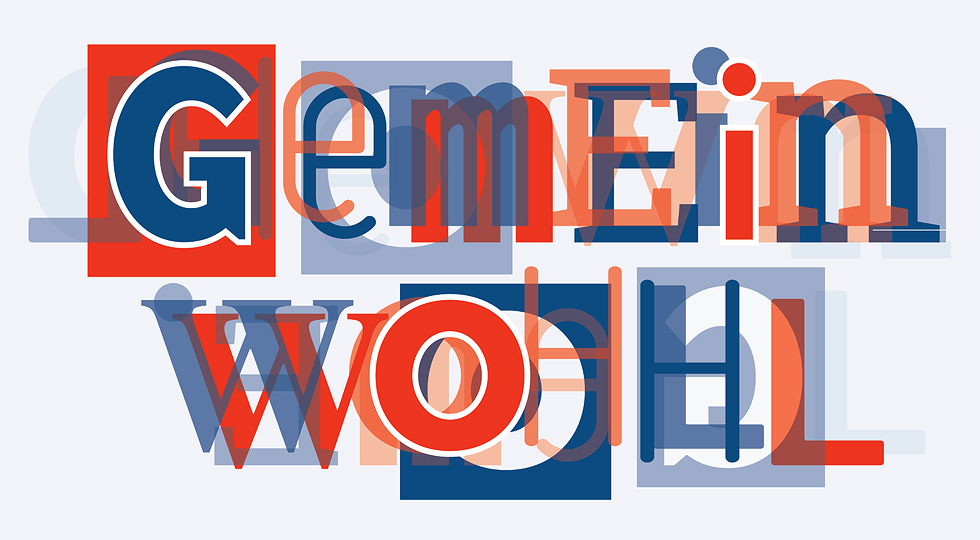Lisa Vollmer verweist in Común #4/Dez. 2020 darauf, dass man ganz genau hinschauen muss, wenn von Gemeinwohlorientierung die Rede ist. Sie zeigt auf, dass (neo)liberale Denktraditionen unter Gemeinwohlorientierung etwas ganz anderes verstehen als etwa linke Basisbewegungen, die unter diesem Schlagwort für eine Stadt für alle kämpfen. Im Folgenden soll es darum gehen, was Gemeinwohlorientierung aus emanzipatorischer Perspektive heißen kann.
Auf einer abstrakten Ebene geht es bei Gemeinwohlorientierung um eine Stärkung solidarischer Beziehungsweisen. Je mehr miteinander, je mehr Kooperation und je weniger Ausschlüsse, desto mehr Gemeinwohlorientierung. Der Gedanke wirkt auf den ersten Blick ein wenig naiv, aber letztlich geht es im Kern darum, konkurrenzbasierte Beziehungen zugunsten von Beziehungen aufzugeben, die auf einem kooperativen Miteinander beruhen.
Kooperation wird oft mit Freiwilligkeit verbunden. Da echte Freiwilligkeit nicht zu bestimmten ist, bietet es sich an, auch von Kollaboration zu sprechen. Dann stellt sich die Frage nach Freiwilligkeit so nicht mehr und es lässt sich viel besser abbilden, was in Netzwerken passiert, indem zusammen etwas auf die Beine gestellt wird. Denn, das kennt jede Aktivist*in vom Plenum, das ist eben nicht immer nur ein kooperatives, harmonisches Miteinander. Für Kollaboration reicht es, wenn Entscheidungen mitgetragen werden, vielleicht nur zähneknirschend, aber immerhin.
Um Gemeinwohlorientierung umzusetzen, bedarf es der Vergesellschaftung einer zu lösenden Aufgabe oder einer zu verwaltenden Ressource. Erst wenn ein Problem als ein gesellschaftliches bzw. ein Problem einer Gemeinschaft anerkannt wird, lässt es sich gemeinwohlorientiert angehen. Dann ist die Wohnungsfrage etwa nicht länger das Problem von Einzelnen, sondern ein Problem aller. Das markiert einen wichtigen Unterschied zu liberalen Denktraditionen: Dort dient das Individuum am ehesten dem Gemeinwohl, wenn es seine eigenen Interessen vertritt und durchsetzt. Mittlerweile gehen einige Wissenschaftler*innen davon aus und können dies auch spieltheoretisch modellieren, dass unter bestimmten Bedingungen Konkurrenz Produktivität blockiert und sich Probleme in kooperativen Netzwerken ressourcenschonender lösen lassen.
Dabei ist es schon erstaunlich, wie üblich es ist, systemische Probleme auf einzelne Akteure abzuwälzen, statt auf Kollaboration zu setzen. Zum Beispiel in der Kommunalentwicklung: So sind manche Kommunen bestrebt, junge kaufkräftige Familien anzuziehen und richten an dieser Zielgruppe ihre Marketing- und Wohnungsmarktstrategie aus. Die Folge ist, dass diese Familien dann woanders wegziehen und je nach Bedingungen in der Kommune andere ärmere Familien verdrängen. Solche Beispiele sind zahlreich: Etwa wenn Einkaufzentren auf der grünen Wiese entstehen oder es um die Ansiedlung von Unternehmen in einer Gemeinde geht. Klar ist, dass der Erfolg der einen, immer durch den Misserfolg an anderer Stelle bezahlt wird, was sich aus gesamtgesellschaftlicher Perspektive als Nullsummenspiel erweist. Wo ein Zentrum entsteht, entsteht eben auch Peripherie.
Die Uneinsichtigkeit kommunaler Akteure in die Nachteile, die dadurch eingekauft werden, wenn man auf den eigenen Vorteil bedacht ist, ist dabei frappierend. Alle hoffen, sich individuell durchzuwurschteln und am Ende auf der Gewinnerseite zu stehen. Das geht am Ende unter Konkurrenzbedingungen genauso wenig, wie in der Bundesliga. Das Spiel funktioniert halt so, dass am Ende der Saison zwei Clubs absteigen, ganz gleich wie sehr sich alle abrackern. Wer das nicht will, muss die Spielregeln insgesamt ändern.
Was sich aus diesem Konkurrenzverhältnis ergeben kann, zeigt sich ganz besonders im Ruhrgebiet. Hier konkurrieren verschiedenste Großstädte auf engsten Raum miteinander. Es gibt zwar interkommunale Strukturen und Kooperationen, aber im Wesentlichen wird versucht, sich gegenseitig die Butter vom Brot zu nehmen. Wenn etwa eine Kommune wie Monheim die Gewerbesteuer abschafft, geht das nur, weil andere nicht nachziehen. Umgekehrt fehlt es an einer Institution jenseits des Staates, die Interessen über Partikularinteressen hinaus formulieren und gestalten kann.
Es braucht eine Institution, die Einzelinteressen zugunsten des Gemeinwohls überwindet und moderiert. Das gilt im Übrigen hinauf zur Weltgesellschaft, um etwa Klimabelange gemeinwohlorientiert zu regeln. Eine solche Institution, wird oft im Staat gesucht und gefunden. Laut Marx sorgt der Staat als ideeller Gesamtkapitalist dafür, dass sich die einzelnen Kapitalien nicht gegenseitig an die Gurgel springen. Und auch Adam Smith kennt Aufgaben, die der Staat zu tragen hat und nicht markfähig sind: Bildung und Straßenbau zum Beispiel.
Braucht es also einen Staat, um Gemeinwohlorientierung umzusetzen? Um es mal so zu formulieren: Öffentliche Daseinsvorsorge, wie soziale Infrastruktur auch genannt wird, hat ihre Meriten, trägt gewiss zum Gemeinwohl bei, aber in Bezug auf solidarischen Beziehungsweisen sind staatlichen Lösungen Grenzen gesetzt. Wenn es um solidarische Beziehungsweisen geht, geht es nicht allein darum, etwas steuerfinanziert als Infrastruktur zur Verfügung zu stellen, das von Beamten verwaltetet wird, sondern auch ein anderes soziales Verhältnis zu etablieren.
Tatsächlich bieten Commons ein Verwaltungsmodell, das vielversprechend an die Stelle von Staat und Markt treten könnte, um Gemeinwohlorientierung im Sinne solidarischer Beziehungsweisen einzulösen. Silke Helferich, eine sehr engagierte Vertreterin der Commons-Idee, betont stets, dass Commons keine Dinge oder Güter sind, sondern sich durch bestimmte Form der sozialen Beziehungen auszeichnen, dem Commoning. Gut funktionierende Commons kombinieren dabei klug, Elemente der Selbstverpflichtung gegenüber dem gemeinsamen Interesse der Einzelnen mit Elementen der Wehrhaftigkeit gegenüber dem Missbrauch durch Einzelne. Mit anderen Worten sind Commons Verwaltungsmodelle, die stark auf gemeinschaftliche Kooperation setzen, aber sich gleichzeitig vor der Aufkündigung der Kooperationsbereitschaft einzelner schützen.
Was das bedeuten kann, ließe sich an verschiedenen Gütern durchspielen. Im Bereich des Wohnens dürfte der Unterschied zwischen Markt, Staat und Commons schnell deutlich werden. Weder Markt, noch Staat können bieten, was Commons schaffen. Die solidarischen Beziehungen der Bewohner*innen in den Miethaussyndikaten, wie sie im Interview mit Helma Haselberger (Común #4/Dez. 2020) dargestellt werden, sind nur in Organisationsformen zu haben, in denen die Nutzer*innen auch gleichzeitig die Möglichkeit zur Verwaltung und Gestaltung haben. Auch die solidarische Vernetzung der einzelnen Projekte untereinander zeigt, dass ein solches Verwaltungsmodell nicht nur lokal begrenzt funktioniert, sondern stärker wird, je mehr Verbindungen geknüpft werden.
Autor
Jörg Kohlscheen ist Sozialwissenschaftler und Linguist.
Illustration
Rainer Midlaszewski