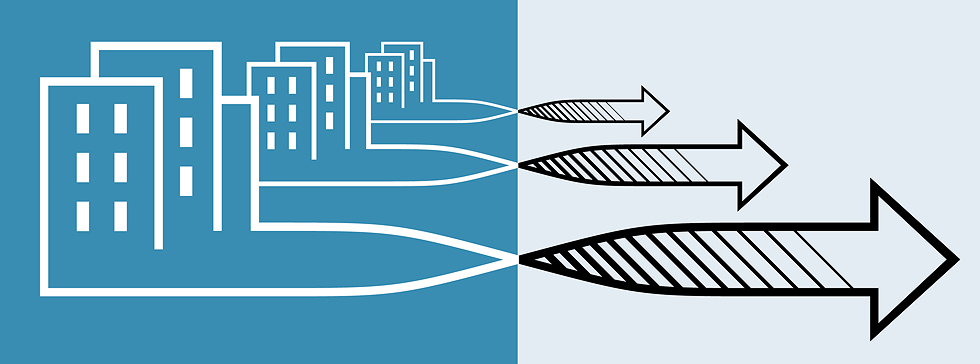Strategische Überlegungen zu einem wachstumskritischen Recht auf Stadt
Die Klimabewegung hat seit drei Jahren Millionen von Menschen rund um den Globus mobilisiert. Dabei ist nur zu offensichtlich, dass die bislang von Regierungen präsentierten „Lösungen“ der schieren Größe des Problems nicht gerecht werden. Für die Transformation wird Städten von vielen Seiten eine entscheidende Bedeutung zugeschrieben. Auch wenn es nicht gleich ein Recht auf Stadt for Future sein muss, erstaunt es dennoch, dass die Debatte um Klimagerechtigkeit in der hiesigen stadtpolitischen Bewegung bislang noch recht wenig Raum bekommt.
Dabei sollte der Griff nach dem Recht auf Stadt nicht abseits, sondern im Mittelpunkt der sozial-ökologischen Transformation stehen. Dieser Beitrag plädiert für eine kritische und selbstbewusste Positionierung der Recht auf Stadt Bewegung in der „Klimafrage“: Das Thema darf weder ignoriert noch anderen überlassen oder neben sozialpolitischen Belangen bagatellisiert werden. Stattdessen lautet der Vorschlag, ganz bewusst den Schulterschluss mit jenen Teilen der Bewegungen für Postwachstum und Klimagerechtigkeit zu suchen, die sich antikapitalistisch, queerfeministisch und antirassistisch verstehen.
Dafür braucht es zuvorderst gute Praxis und funktionierende Mobilisierungen, von denen in dieser Ausgabe viel zu lesen sein wird. Doch für den langen Atem ist Theorie und Debatte mindestens ebenso wichtig, da dadurch strategisch sinnvolle Kriterien für die Transformation gesucht und beibehalten werden können. Denn in der Tat gibt es zahlreiche Ansätze der Nachhaltigkeits- und Klimapolitik, die zu Recht aus stadtpolitischen Kontexten heraus dafür kritisiert werden, entweder de-politisierend und herrschaftsblind, technizistisch und marktkonform oder neokolonial und ausbeuterisch zu sein. Nachhaltigkeit kann nicht einfachso an Forderungen an ein Recht auf Stadt „angehängt“ werden. Um nicht Gefahr zu laufen, sich hier in Sackgassen zu verrennen, ist eine radikale Auseinandersetzung mit Zusammenhängen von Klimakrise, sozialer Ungerechtigkeit und der Art und Weise, wie wir Städte planen, (um-)bauen und in ihnen leben, vonnöten.
Sozial-ökologische Widersprüche?
Zunächst heißt es, Konflikte genau zu betrachten: Landauf, landab werden in stadtpolitischen Diskussionen immer wieder ganz bestimmte Widersprüche politisiert, wodurch sozial- und wohnungspolitische Forderungen gegen klimapolitische Ansätze ausgespielt werden – und vice versa. Lokale Konflikte entbrennen zum Beispiel dort, wo die Stadtverwaltungen pauschal x-tausend Wohneinheiten pro Jahr neu bauen wollen, um der Wohnungskrise zu begegnen. Klar geht dies zulasten von innerstädtischen Freiräumen, wertvollem Boden auf der „grünen Wiese“ (siehe Beitrag von Rolf Novy-Huy) oder dem verbleibenden CO-Budget, weshalb hier medial schnell ein Konflikt zwischen Sozialem und Ökologie herbeiphantasiert wird. Doch bei genauerem Hinschauen wird deutlich, dass der Widerspruch nur ein scheinbarer ist: Die Wohnungsnot maßgeblich über noch mehr (renditeorientierten) Neubau lösen zu wollen, verschleiert die Notwendigkeit der gesellschaftlichen Debatte darüber, wie inmitten der Klimakrise ausreichender und angemessener Wohnraum für alle organisiert werden kann.
Ein Entweder-Oder-Spiel ist auch häufig bei energetischen Sanierungen in Bestandsgebäuden zu beobachten: Eine deutlich erhöhte Sanierungsquote ist für die Einhaltung des 1,5 Grad-Pfades geradezu unabdingbar. Doch die dadurch in Gang gesetzte Aufwertung wird stellenweise instrumentalisiert, um noch höhere Profite zu erzeugen oder ärmere Bevölkerungsgruppen aus bestimmten Stadtvierteln gezielt auszuschließen. Eine mancherorts sichtbare „grüne Gentrifizierung“ (siehe Beitrag von Greta Pallaver) ist letztlich jedoch Effizienz- und Wachstumslogik im grünen Gewand, die soziale Ungerechtigkeit reproduziert. Dabei sind Lösungen für die Kombination aus konsequentem Mieter*innenschutz und klimaneutralem Wohnen möglich und machbar – sie sind allerdings nicht auf der gesellschaftspolitischen Agenda, weil Profitinteressen davon berührt wären. Anstatt sich von diesen Interessen gegeneinander ausspielen zu lassen, braucht es einen klaren Blick auf die Gewalt des Wirtschaftswachstums als eine der Wurzeln des sozial-ökologischen Kollapses.
Postwachstumsstadt und Gegen-Hegemonie
Der Begriff Postwachstumsstadt knüpft an die internationale Debatte zu „Degrowth“ bzw. „Postwachstum“ an, die bereits 1972 mit den „Grenzen des Wachstums“ des Club of Rome begann – und sich mit jeder Wirtschaftskrise zu verstärken scheint. Diese Debatte dreht sich um Fragen der sozial und ökologisch gerechten Transformation der Gesellschaft jenseits einer Fixierung auf kapitalistisches Wachstum. Im Französischen wird übrigens der Begriff „Décroissance“ verwendet, der die beabsichtigte Intervention gut versinnbildlicht: Er bezeichnet den Rückgang eines Flusses in sein ursprüngliches Flussbett nach einer zerstörerischen Flut. Postwachstum als grundlegende Kritik an der Fixierung am Wirtschaftswachstum speist sich aus unterschiedlichen Strömungen der Gesellschaftskritik – Ökologie, Feminismus, Antikolonialismus, Antikapitalismus, um nur einige zu nennen. Insofern steht „Postwachstumsstadt“ für eine intersektionale Kritik an einer wachstumsfixierten Stadtpolitik: Da uns planetare Grenzen gesetzt sind und die Stadtgesellschaften von Ungleichheiten zerrissen werden, müssen wir der Illusion grenzenlosen Wirtschaftswachstums schnellstmöglich entgegentreten.
Entgegen einiger Missverständnisse drückt der Begriff Postwachstumsstadt jedoch nicht beschreibend aus, wie es sich in schrumpfenden Gesellschaften oder Städten lebt. Es geht hierbei auch explizit nicht darum, Verzicht für alle, ungeachtet sozialer Ungerechtigkeiten und Privilegien, zu fordern. Stattdessen betont die Postwachstumsstadt-Perspektive eine postkapitalistische Vision: Es geht um die Repolitisierung und Demokratisierung von stadtgesellschaftlichen Institutionen, von Macht- und Eigentumsverhältnissen. Das omnipräsente Kalkül des ökonomischen Profits – „Rechnet es sich?“ – muss dabei zurückgedrängt werden. Die damit assoziierte unternehmerische Stadtpolitik zu überwinden, heißt, den lokalen Staat nicht als einen homogenen Akteur zu sehen, sondern als Terrain der sozialen Kämpfe.
Das bedeutet auch, nicht allein gegen Personen, Unternehmen oder Verwaltungen zu arbeiten, sondern gleichzeitig die dahinterliegende Hegemonie des Wirtschaftswachstums aufzudecken und anzugreifen. Hegemonie meint dabei die Herstellung von Ideen und Normalitäten, an die viele Menschen in der Gesellschaft glauben. Die Durchsetzung der Idee, dass eine Stadt ein „konkurrenzfähiges“ wachstumsfixiertes Unternehmen sein muss, beruht weniger auf Zwang und Gewalt (auch wenn dies durchaus wichtige Herrschaftsmittel sein können), sondern vielmehr auf der stillschweigenden Zustimmung eines breiten Teils der Gesellschaft. Letztlich wirkt diese Hegemonie deshalb so stabil, weil sie auf unterschiedliche Arten abgesichert ist: Über physische Infrastrukturen, wie Straßen, Parkplätze oder kommerzorientierte Fußgängerzonen; über mentale Infrastrukturen [1], wie Vorstellungen von „Freiheit“ oder „Entwicklung“ und über politisch-rechtliche Infrastrukturen, wie Straßenverkehrsordnung, Bauordnung oder Gemeindefinanzierung.
Für das Problem ursächlich sind also weder individuelle Handlungen noch ominöse „Eliten“ noch ein über allen Dingen stehendes System allein. Vielmehr haben wir es mit der Hegemonie einer zerstörerischen imperialen Lebensweise zu tun. Im Kern müssen daher auch die Kämpfe für eine sozial-ökologische Transformation in der Stadt gegen-hegemonial geführt werden, das heißt mittelfristig sowohl materielle als auch politische und mentale Infrastrukturen verändern. Dafür können drei strategische Überlegungen hilfreich sein.
Drei strategische Überlegungen
Erstens: Niemand muss alles alleine machen. Was sich erst einmal banal anhört, kann ein Schlüssel zu funktionierender Bündnispolitik sein, die durch heterogene Konstellationen auch Widersprüche aushalten kann. Denn erfolgreiche Transformationsbewegungen beinhalten meist die Kombination verschiedener strategischer Logiken der Transformation: [2] Einerseits können disruptive und konfliktorientierte Gruppen mit Protesten und Blockaden auf den Bruch mit bestehenden Machtverhältnissen hinarbeiten und Diskurslinien verschieben. Andererseits zeigen Initiativen, wie Hausprojekte, Wagenplätze oder Stadtteilläden, dass in den Rissen und Nischen kapitalistischer Städte schon heute neue Beziehungsweisen möglich und machbar sind. Letztlich ermöglichen symbiotische Politikformen durch kritische Mitwirkung an Beteiligungsprozessen, Lobbyarbeit, politische Praxis in Stadträten oder Bezirksverordnetenversammlungen die politisch-rechtliche Absicherung der von sozialen Bewegungen erstrittenen Erfolge – und die Abwehr neoliberaler oder rassistischer Rollbacks. Diese Logiken der Transformation müssen nicht darauf überprüft werden, welche von ihnen nun richtiger oder erfolgreicher sei. Stattdessen braucht es gemeinsame Orte und Plattformen für strategischen und vertrauensvollen Austausch zwischen Menschen, die ganz unterschiedliche Vorstellungen davon haben können, was „Politik“ eigentlich einschließt. Im Endeffekt kann dieser strategische Pluralismus dazu führen Transformationsarbeit koordiniert zu betreiben und die eigenen begrenzten Kräfte wirkungsvoller einzusetzen.
Die zweite strategische Überlegung lautet, dass Kämpfe für ein Recht auf Stadt nicht nur lokal geführt, sondern auch translokal in Bewegung gebracht werden müssen. Im Grunde braucht es emanzipatorische Politikansätze, die mit voller Absicht von einer Stadt in die nächste getrieben werden. Positive Beispiele aus den letzten Jahren waren Beschlüsse zum „Sicheren Hafen“ und zum Klimanotstand in hunderten deutschen Kommunen, aber auch die Einführung von Konzeptvergabeverfahren in vielen Großstädten, die zum Beispiel immer mehr neue Hausprojekte ermöglichen. An sich ist diese Überlegung jedoch nicht neu und gründet letztlich auch auf den Strategien, die in entgegengesetzte Richtung seit Jahrzehnten verfolgt werden: Sowohl „Gefahrengebiete“ als auch „Private-Public-Partnerships“ gründen auf translokalem Erfahrungsaustausch der Akteur*innen eines Urbanismus mit autoritärem bis neoliberalem Antlitz. Für stadtpolitische und wachstumskritische Bewegungen ist vor diesem Hintergrund das kritische Voneinander-Lernen, Aufeinander-Beziehen und Gestalten von Lernprozessen über den eigenen Wirkungskreis hinaus von großer Bedeutung. Dabei darf nicht vergessen werden, dass keine Stadt der anderen gleicht: Solidarische Netzwerke ticken überall anders und auch neoliberale Interessensgruppen unterscheiden sich deutlich. Hier wird also Übersetzungsarbeit dringend gebraucht.
Die Welt gerät aus den Fugen, doch eine sinngebende gesellschaftliche Erzählung dazu fehlt: Wie viel Filme beschreiben das Ende der Welt und wie wenige das Ende des Kapitalismus? Die dritte strategische Überlegung handelt daher von der Notwendigkeit, langfristige Visionsarbeit zu betreiben. Dafür braucht es die Verbindung aus konkreten Utopien, widerständiger Praxis und solidarischen Lebensweisen. Die Bilder und Erzählungen, die das gegenwärtige Vakuum zu füllen vermögen, müssen ein gutes Leben für alle, das nicht auf Kosten anderer Menschen oder des Planeten geht, in ihren Mittelpunkt stellen. Um überzeugend, mitreißend und erstrebenswert zu sein, muss diese Erzählung bei den alltäglichen Sorgen, Nöten und Hoffnungen der Stadtbewohner*innen ansetzen: Wieviele Freiheiten gewinnen wir, wenn Wohnen als Gemeingut organisiert ist und wir für die Miete viel weniger (lohn-)arbeiten müssen? Wie verwirklichen wir eine gesunde und günstige Ernährung aus dem unmittelbaren Umfeld? Unnötig zu ergänzen: Natürlich brauchen diese neuen Erzählungen dringend ein – möglichst kitschfreies – Happy End.
Eine Einladung inmitten der Spannungsfelder
Diese Überlegungen enden hier gewiss nicht. Ganz im Gegenteil gibt es im Spektrum zwischen Recht auf Stadt, Klimagerechtigkeit und städtischen Postwachstumspolitiken noch viel auszuloten. Immerhin kommen hier einige Spannungsfelder zusammen: Wie können Netzwerke organisiert werden, die lokale Kämpfe planetar vernetzen, wenn das Ganze schon bundesweit kein leichtes Unterfangen ist? Erfolgreiche „Stadt für alle“-Kämpfe leben von zugespitzten Kampagnen – führen 1,5 Grad kompatible Szenarien dann nicht leicht zu Überkomplexität und Überforderung? Wie weit kommen soziale Bewegungen mit gewaltfreier Mobilisierung und in welchen Kontexten kann friedliche Sabotage ein adäquates Mittel sein? Und nicht zuletzt: Auf welche Weise kann Raumnahmen von völkischen Rechten, die wachstumskritische Argumente kapern, begegnet werden? Dieser Text soll als Einladung verstanden werden, diese und weitere Fragen konkret zu beraten. Letztlich braucht es Rat und Tat, damit das Recht auf Stadt auch das Recht auf Leben auf einem bewohnbaren Planeten einschließt.
Autor
Anton Brokow-Loga ist Aktivist und Stadtforscher. Im Mai 2020 hat er mit dem »Kollektiv Raumstation« das erste digitale »Recht auf Stadt Forum« realisiert. Er lebt in Weimar und ist dort parteiloser Stadtrat. An der Bauhaus-Universität Weimar beschäftigt er sich vor allem mit städtischen Transformationsprozessen. Zuletzt erschienenes Buch: Stadtpolitik für alle. Städte zwischen Pandemie und Transformation (2021, Graswurzelrevolution).
Weiterlesen
Brokow-Loga/Eckardt (Hrsg.) 2020: „Postwachstumsstadt. Konturen einer solidarischen Stadtpolitik“, auch online hier: ▷ postwachstumsstadt.de
Anmerkungen
[1] Ein Begriff, den der Sozialpsychologe Harald Welzer (2011) geprägt hat, um unbewusste Denkstrukturen und kulturelle Praktiken zu beschreiben.
[2] In Anlehnung an die Elemente einer Theorie der Transformation von Erik Olin Wright: Wege aus dem Kapitalismus (2017).