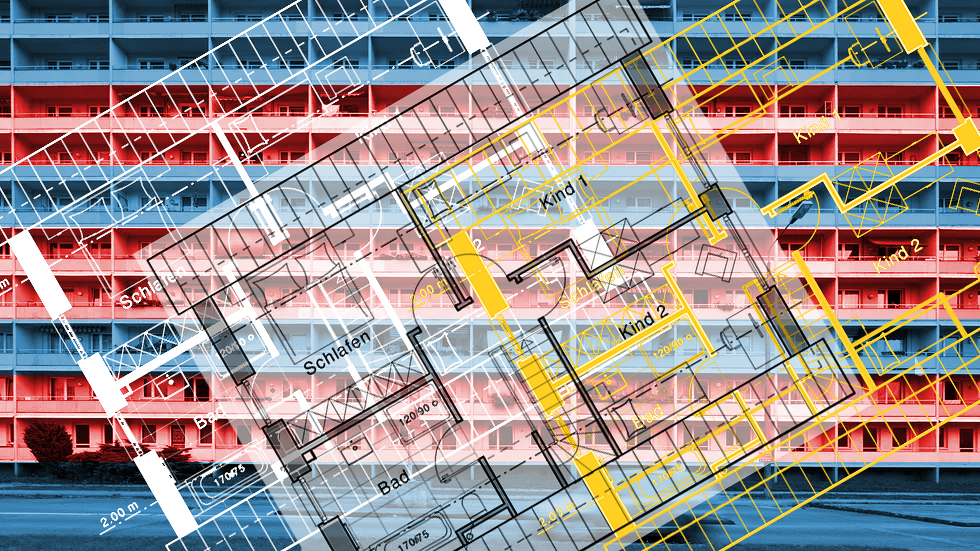Die Neoliberalisierung der Wohnungsversorgung und die strukturelle Individualisierung von Care-Arbeit verräumlichen Geschlechterverhältnisse, prägen somit die Wohnsituation vieler – insbesondere alleinerziehender Mütter – und stellen sie vor große Herausforderungen im Alltag.
Janne Martha Lentz
Als Ayla mir die Tür öffnet, stehen wir in einem Zimmer, das gleichzeitig Küche, Wohnzimmer und Schlafzimmer ist. Ein selbstgebautes Etagenbett mit Schreibtisch darunter grenzt ihren privaten Bereich vom Rest des Zimmers mit Küche und Essbereich ab. Ein Raum, der alle Aufgaben des Wohnens auf kleinster Fläche miteinander vereint. Ayla ist 26, alleinerziehende Mutter und lebt in einer Sozialwohnung in Hamburg. Ich habe mit ihr im Rahmen meiner Forschung zu den Wohnbedürfnissen alleinerziehender Mütter in Hamburgs Sozialwohnungen gesprochen. Ihre Sozialwohnung besteht, entsprechend den Vorgaben der Hansestadt, aus zwei Zimmern. Dass eine offene Küche auch als ganzes Zimmer zählt, ist nun zu Aylas Nachteil, die, um ihrer Tochter ein eigenes Zimmer zu ermöglichen, auf ein eigenes Schlafzimmer verzichtet. Eine Sozialwohnung, in der beide über ein eigenes Schlafzimmer verfügen, steht ihr zwar zu, war aber auf dem unterversorgten Hamburger Sozialwohnungsmarkt nicht vorhanden.
Aylas Situation steht sinnbildlich für diejenige vieler Menschen, die Care-Arbeit in einer Gesellschaft leisten, in der neoliberale Politik Care-Tätigkeiten als Privatangelegenheit betrachtet und das Individuum dafür verantwortlich macht. Somit wird Care-Arbeit, insbesondere unbezahlte, strukturell unsichtbar gemacht. Dies hängt auch mit der Arbeitsteilung nach Geschlechtern und der Wahrnehmung der Wohnung als weibliche, reproduktive Sphäre der Frauen* zusammen. Wohnungspolitik ist, auch wenn sie Care-Arbeit nicht explizit berücksichtigt, stark normativ und orientiert sich meist am Ideal der Kleinfamilie, was sowohl den Zugang zu Wohnraum als auch das Design der Wohnungen selbst prägt. Dies gilt insbesondere für den sozialen Wohnungsbau, in dem die Wohnungspolitik Faktoren wie Zugangskriterien und Wohnfläche pro Person vorgibt und somit stark disziplinierend darauf einwirkt, wer Zugang zu staatlicher Versorgung erhält. Gleichzeitig bestimmt der Zugang zu Sozialwohnungen für viele, insbesondere alleinerziehende Mütter, in welchem räumlichen Rahmen sie für sich und ihre Kinder sorgen.
Wie Aylas Beispiel zeigt, geht es nicht nur um die faktische Versorgung mit bezahlbarem Wohnraum, sondern auch um die Qualität und Angemessenheit jener Wohnungen.
Wie Aylas Beispiel zeigt, geht es nicht nur um die faktische Versorgung mit bezahlbarem Wohnraum, sondern auch um die Qualität und Angemessenheit jener Wohnungen. Dies illustriert ein generelles Manko der aktuellen Debatte um die Wohnungskrise, die sich hauptsächlich auf die Anzahl bezahlbarer Wohneinheiten fokussiert und den Gebrauchswert dieser Wohnungen vernachlässigt. Der Gebrauchswert von Wohnungen spielt im Alltag und für alltägliche Care-Arbeit jedoch eine große Rolle. Sowohl die Aufteilung und Größe der Wohnung als auch die Ausstattung und Lage des Wohnhauses definieren die alltägliche Care-Arbeit, die in unserer Gesellschaft immer noch strukturell hauptsächlich von Frauen* übernommen wird. Dies wird auch am Fallbeispiel Hamburg deutlich: Obwohl seit 2020 in den Förderrichtlinien für den sozial geförderten Wohnungsbau verankert ist, dass die Wohnungen genderrelevanten Qualitätsanforderungen genügen sollen, wird nirgends definiert, was das eigentlich bedeutet.
Dies führt dazu, dass Situationen wie die von Ayla keine Seltenheit sind. Alleinerziehende in Hamburg nehmen oft Wohnverhältnisse in Kauf, die ihre Sorgearbeit erschweren, da die hochpreisigen Mieten auf dem freien Wohnungsmarkt für sie als Alleinverdienerinnen nicht bezahlbar sind und die Auswahl durch mangelndes Angebot an Sozialwohnungen stark eingeschränkt ist. Konsens unter den befragten alleinerziehenden Müttern war somit, dass das Verfügbare genommen werden musste. So blieb Binay in einer von Missbrauch geprägten Beziehung, bis sie eine Wohnung fand; wohnte Sehra mit ihren beiden Söhnen fast ein ganzes Jahr lang bei ihren Eltern, bis eine Wohnung in angemessener Größe und mit entsprechender Aufteilung in ihrem bevorzugten Viertel frei wurde.
Sehra wartete auch deshalb so lange auf eine Wohnung, da für sie die räumliche Nähe ihres Support-Netzwerkes unabdingbar für die Bewältigung ihres Alltages und ihrer Care-Verpflichtungen ist. Die Erreichbarkeit ihrer Eltern und Geschwister ermöglicht es ihr, Teile ihrer Sorgearbeit abzugeben. Dies war für Ayla nicht möglich. Ihre Situation mit einem Neugeborenen im Studierendenwohnheim brachte sie dazu, in eine Sozialwohnung zu ziehen, die mit öffentlichen Verkehrsmitteln schlecht an ihre alte Nachbarschaft und ihre dort bestehenden Netzwerke angebunden ist. Die strukturelle Unterversorgung mit Sozialwohnungen bzw. bezahlbarem Wohnraum im gesamten Stadtgebiet führt also zu Verdrängung alleinerziehender Mütter. Diese haben, um an bezahlbaren Wohnraum in einer Stadt, die von Mietanstiegen geprägt ist, zu gelangen, kaum Möglichkeiten, Wohnraum zu beziehen, der ihren Wohnbedürfnissen entspricht.
Die spezielle Dichotomie von Wohnen als Ware und dem Gebrauchswert des Wohnens ist besonders bedeutsam für diejenigen, für die das Wohnen im Mittelpunkt der täglichen Care-Praxis steht und die gleichzeitig mit dem wirtschaftlichen Nachteil leben, dass eben diese Care-Arbeit weder entlohnt noch gesellschaftlich wertgeschätzt wird. Die strukturelle Verbindung zwischen Care-Arbeit und Wohnen hat zwei Konsequenzen: Zum einen individualisiert sie die Verantwortung für die Care-Arbeit, zum anderen verlagert sie die Sichtbarkeit der Care-Arbeit vom öffentlichen Bereich in den privaten. Beides führt zu einer strukturellen Unsichtbarkeit von Care-Arbeit, da diese in der öffentlichen Wahrnehmung aus der Verantwortung des Sozialstaats herausfällt. Da Care-Arbeit immer noch strukturell von Frauen* getragen wird, ist diese soziale und räumliche Konstruktion des Privaten im Gegensatz zum Öffentlichen innerhalb des modernen westlichen Heimideals grundlegend sexistisch und klassistisch.
Im Sozialwohnungsbau zeigt sich dies vielleicht am stärksten, da durch Förderrichtlinien staatliche Wertvorstellungen im Sinne von Grundrissen, Wohnungsgrößen und Wohnlagen in Beton gegossen werden.
Eine feministische Betrachtungsweise des Rechts auf Stadt fordert daher schon lange, anzuerkennen, dass das Recht auf Stadt nicht nur im öffentlichen Raum, sondern auch im Privaten, im Wohnraum, ausgehandelt und gelebt wird (siehe Freshinski in Común #1). Der Fokus auf den Gebrauchswert von Wohnraum illustriert, wie stark sich strukturelle Machtverhältnisse im Privaten abbilden. Im Sozialwohnungsbau zeigt sich dies vielleicht am stärksten, da durch Förderrichtlinien staatliche Wertvorstellungen im Sinne von Grundrissen, Wohnungsgrößen und Wohnlagen in Beton gegossen werden. Familien in Konstellationen abseits des patriarchalen Kleinfamilienideals, wie die anfangs beschriebene von Ayla, müssen in Wohnungen leben, die ihren Bedürfnissen überhaupt nicht entsprechen. Dies beeinflusst nicht nur, wie Menschen ihre Care-Arbeit im Privaten verrichten, sondern auch, wie viel solidarische Unterstützung sie dabei erfahren.
Die befragten Mütter schlugen dabei mehrfach die Möglichkeit von Häusern für Alleinerziehende vor, in denen Care-Arbeit sowohl in privaten Wohnungen als auch kollektiviert in gemeinschaftlichen Räumen ausgehandelt und gestaltet werden kann. In den 1990er Jahren fanden sich solche selbstorganisierten Wohnformen bereits in Hamburg. Allerdings sind solche Projekte durch den strukturellen Zeit- und Geldmangel für die meisten Alleinerziehenden weder organisierbar noch verfügbar.
Institutionell sind solche Wohnformen in Hamburg bisher hauptsächlich für Menschen mit Behinderung in sogenannten Cluster-Wohnungen erprobt. Ähnliche Angebote gibt es aber bereits in Wien, wo solche Wohnformen von dem Verein »JUNO« in Zusammenarbeit mit den Bauträgern angeboten werden. Die alleinerziehenden Eltern bewerben sich dann direkt über den Verein auf eine Wohnung. Der Verein regelt aber nicht nur den Bezug, sondern hilft, durch das Zusammenleben zu navigieren, und gibt Hilfestellungen zum gemeinsamen Sorgetragen. Der Wunsch nach Solidarität und gemeinschaftlicher Gestaltung des Alltags von Alleinerziehenden kann als direkte Kritik der patriarchalen und neoliberalen Individualisierung von Sorgearbeit verstanden werden und ist ein weiterer Ausdruck des feministischen Credos „Das Private ist politisch“.
Es kann natürlich immer darüber diskutiert werden, wie sinnvoll es ist, solche Veränderungen in städtische Verantwortung zu legen. Auch wenn die Stadt Hamburg im Rahmen meiner Forschung klar feststellte, dass es beabsichtigt ist, Investor:innen für Sozialwohnungen so wenig wie möglich vorzuschreiben, zeigt zumindest die Einführung der „genderrelevanten Qualitätsanforderungen“ für die Förderrichtlinien für Sozialwohnungen im Jahr 2020 den ersten Willen. Nun ist es an der Zeit, das starre Konzept „sozialer Wohnungsbau“ aufzubrechen und verschiedene Wohnformen förderfähig zu machen, die eben nicht alle an das heterosexistische Kleinfamilienideal gebunden sind.
Anmerkung der Autorin: Ich möchte darauf hinweisen, dass in diesem Text zwar nur von Männern und Frauen und insbesondere von Müttern die Rede ist, dass ich aber von der Erkenntnis ausgehe, dass Geschlechterrollen gesellschaftlich konstruiert sind und dass es eine größere Bandbreite von Geschlechtern außerhalb dieser Binarität gibt. Ich habe mich entschieden, Frauen mit einem * zu kennzeichnen, um den Spagat deutlich zu machen zwischen einer strukturellen, gesellschaftlichen Binarisierung der Geschlechter und der damit einhergehenden sozialen Konstruktion von Weiblichkeit sowie den materiell spürbaren Folgen, die sowohl Cis- als auch Transfrauen treffen. Während ich finde, dass alle, die sich als solche verstehen, Frauen sind, muss ich in meiner Forschung mit Statistiken und Materialien arbeiten, die geschlechtliche Vielfalt binarisieren. Ohne eine eindeutige Lösung anzubieten, markiere ich dieses Dilemma daher mit einem *.
Autorin
Janne Martha Lentz ist Wissenschaftlerin an der Uni Graz und forscht zu feministischen Perspektiven auf Care-Arbeit, Wohnungspolitik und Stadt. Dieser Text bezieht sich auf ihre Forschung zu Sozialwohnungen als Care-Infrastruktur.
Weiterlesen
▷ Dokumentation Frauenwohnprojekte
▷ JUNO – Zentrum für Getrennt- und Alleinerziehende (Wien)
▷ E. N. Freshinski (Nina Fraeser & Eva Kuschinski): Beziehungsweise Recht auf Stadt – Feministische Perspektiven auf Formen kollektiver Stadtgestaltung in Común #1
Titelillustration
Rainer Midlaszewski